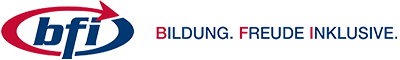DerStandard: "Wir brauchen keine kleinen Programmierer"
Wien – „Schule 4.0“ rollt derzeit Lehrinhalte für den Erwerb digitaler Kompetenzen aus – von gesellschaftlichen Aspekten bis zum technischen Verständnis. Der Geschäftsführer des BFI Wien, Franz-Josef Lackinger, nützt als Anbieter digitaler Kurse und Trainings (Digi-Campus) die Chance und versammelt Fachleute und (Weiter-)Bildungsexperten zur provokanten Frage: Coden und Programmieren schon in der Volksschule? „Gerade jetzt breite Universalbildung oder Coden, Hacken, Löten in den Schulen?“, spannt er das Thema auf.
Die Meinungslage der rund 60 Diskutierenden insgesamt vorweg: Eher nicht Programmieren für alle Volksschüler, und wenn, dann nicht statt anderer „Kulturtechniken“ sondern in Verbindung mit diesen oder zusätzlich. Lediglich Anbieter von (privaten) Codingschulen sagen klar, dass Programmieren so früh und so flächendeckend wie möglich zu lehren sei. So auch Lackinger sinngemäß: Dahinterschauen können, wie Maschinen funktionieren, aber nicht notwendigerweise aller Programmiersprachen mächtig sein.
Expliziter ist da der oberste Gewerkschafter der Pflichtschullehrer, Paul Kimberger: „Wir brauchen keine kleinen Programmierer in den Volksschulen. Wir kämpfen um das Vermitteln von Kulturtechniken, wir kämpfen mit sozialer Verwahrlosung.“ Selbstverständlich sei Digitalisierung auch als gesellschaftliches Phänomen in Schulen aktiv anzugehen, „natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Kinder vorbereiten, aber doch nicht nur auf das Arbeitsleben, es geht doch auch um Menschenbildung, um Moral, Ethik, Werte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie – das geht nicht mit einem ausgeteilten iPad, dazu brauchen wir Dialog, Vorbilder, das ist ein Prozess“. Kinder müssten auch Kinder sein dürfen, mahnt Kimberger und plädiert dagegen, lediglich digitalen Supermächten und Nationen mit höchster Roboterisierung hinterherzulaufen. „Wir müssen die Kinder auch lehren, die Geräte wieder aus der Hand zu legen und spielen und singen zu gehen.“
Dass die Ausstattung der Schulen unter internationalem Niveau liege und flächendeckendes Breitband in zehn Jahren kein brauchbarer Plan sei, wiederholt Kimberger ebenso wie seine Haltung, dass es Technik und Pädagogik in Kombination benötige.
Da trifft er sich mit Andreas Salcher, Bestsellerautor, Bildungsexperte und einer, der pro bono als Berater im Cluster Bildung tätig war: „Ich muss nicht Bücher drucken können, um Bücher lesen zu können. Steve Jobs konnte auch nicht programmieren.“ Salcher ist kein Fan von verpflichtendem Coden schon ab der Volksschule: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Schweinezyklen und Tulpenhypes schaffen. Was jetzt gefragt und hoch bezahlt ist – wer sagt, dass das in zehn Jahren noch genauso ist angesichts der dramatischen Entwicklung von künstlicher Intelligenz?“ Salcher warnt eindringlich davor, einen Weg der „Konkurrenz mit Computern“ zu beschreiten. Am wirksamsten sei noch immer die Kombination menschlicher Kreativität mit den Stärken und dem Können von Computern. Damit erfährt er erwartungsgemäß allgemeine Zustimmung.
Als Bonmot dazu zitiert er Garri Kasparow, nachdem dieser die Schachpartie gegen den Computer Watson verloren hatte: Er könne sich ärgern, der Computer könne sich allerdings nicht freuen.
Kimberger fällt Albert Einstein ein: Er fürchte sich vor der Zeit, in der die Technik die Menschlichkeit überholt.
Catrin Meyringer, die gemeinsam mit dem BFI Wien RoboManiac nach Österreich gebracht hat und Schulkindern dort spielerisches Lernen von Robotik beibringt, befreit Programmieren von simplen Zuschreibungen: Auch dabei gehe es ja um ein Mehr im Lernen – Teamarbeit, Fehler finden, scheitern und wieder neu beginnen, aktiv gestalten.
Kinder sollen lernen zu verstehen, was sie tun, formuliert Gabriele Prokop, Direktorin der Marie-Jahoda-Volksschule in Wien-Ottakring ihr Anliegen noch abseits des Wie der strukturellen Implementierung in Schulen. Die meisten seien sowieso schon „im Zug“, weil auch Primärstufen seit geraumer Zeit mit allen Seiten der Digitalisierung der Kleinen konfrontiert sind. (kbau)