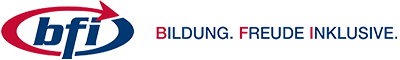Die Presse: Lesen, schreiben, programmieren?
Die Begeisterung für Mint-Fächer muss schon von klein auf geweckt werden, das gilt als Konsens aller Experten. Aber wie früh und mit welchen Mitteln? Ist es etwa sinnvoll, Kindern schon in der Volksschule programmieren beizubringen? Mit dieser konkreten Frage beschäftigte sich ein vom BFI Wien organisierter "ExpertenClub". Hintergrund sind einschlägige Pläne der Regierung im Zuge der beabsichtigten Digitalisierung der Bildung.
Didaktik vor Technik
Andreas Salcher, Buchautor, der auch ehrenamtlich die Regierung beraten hat, bricht eine Lanze für die Möglichkeiten der Digitalisierung, wobei er lieber von der Digitalisierung des Lernens als der Digitalisierung der Bildung spricht. Als Positivbeispiel nennt er die unter anderem von der Gates Foundation und von Google unterstützte Khan Academy, eine Sammlung von kurzen YouTube-Videos, die den Lernstoff in "kleine Häppchen" aufteilt. Die nächste Stufe wäre, Online-Inhalte mit eigener Erfahrung zu verknüpfen. Salcher propagiert das Konzept des "flipped classrooms", in dem der Schüler selbstständig lernt und dem Lehrer bei Bedarf Fragen stellt. Seiner Meinung nach wird der technologische Aspekt überbewertet, was es brauche, sei ein an die neuen Möglichkeiten angepasstes pädagogisches Konzept.
Bei aller Begeisterung für digitale Hilfsmittel meint er allerdings nicht, dass jedes Kind coden können muss. "Ich muss kein Buch drucken können, um lesen zu könen." Seiner Ansicht nach ist die jetzige Nachfrage nach Programmierern ein kurzlebiger "Schweinezyklus", in Zukunft übernehme Künstliche Intelligenz viele ihrer Aufgaben. "Der Mensch muss sich auf das konzentrieren, was nur er kann", sagt Salcher.
Auf die Situation an den Schulen geht Gabriele Prokop, Volksschuldirektorin in Ottakring, ein. Für sie kommt die Diskussion etwas spät, da sich viele vor allem jüngere Lehrer schon länger mit dem Thema beschäftigten.
Defizite in anderen Bereichen
Was es braucht, sei ein Rahmen, der die Bedürfnisse von Kindern und Lehrern umfasst. Hier weist die Pädagogin auf andere Aspekte hin, die ebenfalls Aufmerksamkeit brauchten, insbesondere beobachte sie bei den Kindern zunehmend Defizite im sensomotorischen Bereich, der eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den Bildungserwerb sei. Sie hält daher wenig von einem Pflichtfach Programmieren in der Volksschule, befürwortet aber ein entsprechendes optionales Angebot. "Schule darf sich nicht verschließen. Die Kinder sollen - Stichwort Sicherheit und Privatsphäre - wissen, was sie tun." Das Schlüsselwort sei Achtsamkeit bezüglich verschiedener Wünsche und Bedürfnisse der Kinder. Man müsse angesichts von Bewegungsarmut und Anforderungen an die Sprachkompetenz die Mitte finden.
In eine ähnliche Kerbe schlägt Paul Kimberger, Vorsitzender der Arge LehrerInnen. "Digitalisierung ist ein gesellschaftliches Phänomen, Schule muss proaktiv gestalten und Kinder auf die Welt von morgen vorbereiten." Allerdings gehe es dabei nicht nur um die Arbeitswelt, sondern auch etwa um Fragen der Moral. Was den Stellenwert des Lehrers und die persönliche Interaktion angeht, so ist diese für den Lehrervertreter weiter zentral und darf nicht auf die Rolle eines "Coaches, der wie ein Helikopter herumschwirrt" reduziert werden. Skeptisch ist Kimberger auch bezüglich Gratis-Online-Angeboten, hinter denen immer große Firmen mit kommerziellen Interessen stünden. Er wünscht sich ein Angebot der öffentlichen Hand, das in einem bundesweit einheitlichen Roll-out eingeführt wird. Weiters weist auch er auf Defizite vieler Schüler hin, die etwa durch Sozial- und Wohlstandsverwahrlosung entstehen und vordringlich beachtet werden müssten. "Kinder müssen lernen, mit den Geräten umzugehen, aber auch, wann sie sie weglegen sollen", sagt der Experte.
"Nicht statt, sondern zusätzlich" ist das Motto, das Catrin Meyringer bezüglich Programmieren in der Volksschule propagiert. Meyringer ist Geschäftsführerin von RoboManiac, die Programmier-Workshops für Kinder und Jugendliche anbieten. Sie plädiert für einen spielerischen Zugang und betont, dass Mint nicht nur Codeschreiben umfasse. Die Robotik sei eine Möglichkeit, ein abstraktes Thema anschaulich zu machen. Dazu gebe es kindgerechte Angebote wie Programmieren von Robotern durch Farbcodes.
Schützenhilfe erhält sie aus dem Publikum von Anna Relle Stieger, Geschäftsführerin der Programmierschule Acodemy, die unter anderem Kurse für Kinder anbietet. Sie weist darauf hin, dass diese mit dem Programmieren nicht nur Technik lernen, sondern auch kreatives Denken, Fehlersuche und Fehlertoleranz sowie Teamwork.