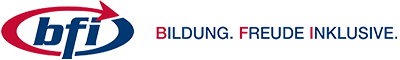Programmieren ab der Volksschule - macht das Sinn?
Ist es sinnvoll, vertretbar, oder vielleicht sogar unbedingt notwendig, dass Kinder ab der ersten Klasse Volksschule programmieren lernen, wie es im Regierungsprogramm steht? Dieser Frage ging ein hochkarätig besetzter ExpertenClub auf Einladung des BFI Wien nach. Zwei Dinge stellten sich dabei rasch heraus: Dass die Digitalisierung des Unterrichts offenbar nicht mehr zu stoppen ist. Und dass es keine einhellige Meinung darüber gibt, ob das gut oder schlecht ist.
LehrerInnen als Lernbegleiter im "Flipped Classroom"

Buchautor und Bildungskritiker Andreas Salcher glaubt etwa, dass die Zukunft der Schule im „Flipped Classroom“ liegen wird: Die SchülerInnen und Schüler erarbeiten sich den Unterrichtsstoff selbstständig und in kleinen Häppchen, etwa über Online-Lehrvideos, und besprechen im Unterricht die Ergebnisse. Salcher: „Bislang ist es so, dass der Lehrer den Unterricht mehr oder weniger frontal taktet. Beim digitalen Lernen ändert sich die Funktion des Lehrers: Er wird zum Lernbegleiter oder Lerncoach.“ Ein Freund des Codings an der Volksschule ist Salcher dabei keiner: „Ich warne davor, mit dem Computer auf Gebieten zu konkurrieren, wo er uns schlagen kann. Beim digitalen Lernen geht es um einfache didaktische Tools, aber die scheitern oft am fehlenden pädagogischen Konzept.“
Wer meine, dass man Lehrer und Lehrerinnen auf Lernbegleiter oder Coaches reduzieren könne, der würde sich irren, widerspricht Paul Kimberger, oberster LehrerInnen-Vertreter in der GÖD. „Wir müssen Kinder auf die Welt von morgen vorbereiten, nicht nur auf die Arbeitswelt: Es geht um menschliche Werte, hier werden Pädagogen immer eine zentrale Rolle spielen“, meint Kimberger. „Wir kämpfen darum, dass wir Kulturtechniken vermitteln, dass wir Kreativität ermöglichen. Motorische Defizite und Entwicklungsrückstände, all das muss berücksichtigt werden.“
Programmieren fördert die Kreativität

Die Lanze für Coding ab der Volksschule bricht zuletzt Catrin Meyringer, Geschäftsführerin von RoboManiac, einem Anbieter von Programmier-Workshops für Kinder und Jugendliche. Kinder würden durch Programmieraufgaben, die sie fächerübergreifend im Team lösen könnten, Kreativität, Lösungskompetenz und Innovation lernen, so Meyringer: „ Ja, Roboter wird in vielen Bereichen besser sein als wir. Der Mensch muss Roboter bauen und programmieren. Das werden die künftigen Berufsfelder unserer Kinder sein“ - ein Statement, das später in der sehr angeregten Publikumsdebatte mit der lapidaren Meldung versehen wird, dass es neben Coding wohl auch andere Berufe geben wird: „Ich glaube nicht, dass uns der Computer die Tapeten an die Wand pickt.“
Aber wer weiß?

Die Geschäftsführer des BFI Wien: Franz Josef Lackinger (ganz lins) und Christian Nowak (ganz rechts).